„Orientierung im digitalen Maschinenraum“ – Rezension von Miloš Vec über „Gewissensbisse“ (Online / Print: 3.3.2010, S. 28)
|
||||
|
Gerade erschien im Informatik Spektrum unser Plagiatsfall, da diskutiert eine breite Öffentlichkeit den Hegemann-Fall. Die Autorin Helene Hegemann wurde „beim Mogeln“ erwischt, Teile ihres Romans sind plagiiert. Ohne auf die näheren Umstände dieses Plagiatsfalls und die dreisten Verteidigungsargumente eingehen zu wollen, ist ein Aspekt auch für die allgemeine Diskussion über das Abschreiben und Kopieren ohne Quellenverweis interessant: Die Frankfurter Rundschau stellt in dem Artikel Der Abgeschriebene nämlich den eigentlichen Urheber in den Vordergrund. Er kann sich natürlich nicht aussuchen, das Opfer eines Plagiators zu werden, auch hat er keine Wahl, welcher Text zu welcher Zeit von ihm kopiert wird: „Ob er es nun will oder nicht: Das Plagiat von Helene Hegemann hat ihn berühmt gemacht.“ Der Betroffene sollte auch im wissenschaftlichen Kontext in der ethischen Debatte nicht zu kurz kommen. Debora Weber-Wulff [A real case] A company was started in Iceland in 1996 and was working on determining genetic markers for specific diseases. When the human genome was sequenced in 2003 the company began storing the data for all of the inhabitants of Iceland. There are only 300.000 inhabitants and they are quite strongly interrelated. In addition, the government has a lot of publically obtainable information about the inhabitants, that can easily be linked to other data using the tax number that every citizen is given. The Icelandic government also gave the company access to all health records in the country. Icelanders are very enthusiastic about science and modern technology, and they willingly lined up to donate their data and DNA. The company managed to set up a complete database, and was finding many interesting markers for certain kinds of diseases, and were successful in finding many markers for diabetes and some forms of cancer. But the Icelandic economy took a nosedive in 2008, and before long there was no money to continue the operation. The company filed for bankruptcy and began selling off assets to cover their debt. The company was discovered to be in litigation against five former researchers, who left the company and moved to the United States, taking copies of the data with them. The researchers had been working on some long-year projects on determining predisposition to certain forms of cancer and were worried that the data might disappear if the company went broke. An Icelandic woman had also sued the company to keep them from disclosing information about her and her now deceased father. Since she shares half of his genetic markers, releasing his health records would make information about her available. She won her case before the Icelandic Supreme Court, who determined that the company had not properly observed Icelandic privacy laws. Questions:
Created for a workship for the Master’s Program in Computational Neuroscience, Charité, Berlin in 2010. Debora Weber-Wulff Personal Health Records are all the rage. Do you remember what X-rays you have had or the names of the medicines that you regularly use? What were your blood cholesterol levels last year? The company Health & More offers a personal online health record that provides a complete and accurate summary of the health and medical history for their customers by gathering data from many sources, including their fitbits, and making this information accessible online to anyone who has the necessary electronic credentials to view the information. In particular, Health & More collects information about
In order to finance this service, which is offered to customers for a very low price, Health & More sells de-anonymized data to interested parties, both medical researchers, health care providers, and marketers. But the health plan – for no clear reason – refused to offer her coverage for breast cancer, unless she paid a very high additional monthly fee. Inge managed to discover that the health plan provider was also a customer of Health & More. But it was not possible for her to discover the reasons why she was denied coverage Questions
Created for a workship for the Master’s Program in Computational Neuroscience, Charité, Berlin in 2010.
Debora Weber-Wulff, Wolfgang Coy Chris sitzt in der Cafeteria. Sie hat bis spät in die Nacht über ihrer Hausarbeit gebrütet, an der sie seit Wochen saß. Sie musste viel Zeit in der Bibliothek verbringen und mit präzisen Formulierungen ringen, aber Prof. Laub legt Wert auf klare Aussagen. Die Arbeit scheint ihr nun ganz ordentlich. Chris ist mit sich zufrieden. Alle Hausarbeiten waren morgens um 9 Uhr im Sekretariat abzugeben; danach fand sich das ganze Semester in der Cafete ein. Am Nebentisch sitzt Karsten aus ihrem Semester, der bei Partys gern Musik auflegt. Er trinkt einen Latte und unterhält den Tisch mit seinen Geschichten. So erzählt er, welches Glück er mit seinem Thema hatte, weil es dazu bereits zwei Aufsätze bei einer Hausarbeitsbörse im Internet gibt. Er hat sich eine dieser Arbeiten gekauft – sie war mit einer 1,0 benotet worden. Er formatierte sie neu, setzte seinen Namen darunter und gab sie am Morgen im Sekretariat ab. So war er gestern früh fertig und konnte die Nacht im Club durchfeiern – mit einer „heißen BWL-Tusse,“ die er dort kennengelernt hat. Chris ärgert sich, dieses dumme Getue anhören zu müssen. Am meisten aber ärgerte sie die Sache mit der abgeschriebenen Arbeit. Da sie aber nicht an dem Gespräch beteiligt ist, kann sie schlecht rübergehen und sagen, dass sie sein Verhalten mit der Hausarbeit nicht richtig findet. Die Noten werden Anfang des nächsten Semesters halbanonym am Schwarzen Brett publiziert – statt Namen stehen dort Matrikelnummern. Im Semester wissen freilich alle, wer welche Nummer hat. Chris sucht ihre Nummer und freut sich: eine 2,0, ihre Arbeit hat sich gelohnt. Sie weiß auch Karstens Matrikelnummer, zögert aber einen Augenblick, seine Note nachzuschlagen. Aber sie kann es sich doch nicht verkneifen: Und siehe, Karsten hat eine 1,3. Nun ist Chris wirklich wütend. Was soll sie machen? Zu Prof. Laub gehen? Karsten zur Rede stellen? Sich in der Fachschaft beraten lassen? Sie seufzt: Die Ehrliche ist immer die Dumme. Fragen In diesem Szenario werden verschiedene Fragestellungen aufgeworfen. Es berührt ethische Fragen ebenso wie rechtliche Aspekte des Urheberrechts, des Betrugs und des Datenschutzes. Trennen Sie diese Aspekte, soweit es möglich ist.
Erschienen im Informatik Spektrum 33(1), 2010, S. 85
Auf Seite 182 in der c’t 2/2010 hat Wilfried Niederkruger unser Buch rezensiert: „Ein kleines Buch mit großem Nutzen“. Wir freuen uns!
|
||||
|
Copyright © 2026 GI-Fachgruppe Informatik und Ethik - CC-BY-SA
Powered by WordPress & Atahualpa |
||||

 Die
Die  Ralf E. Streibl hat eine Rezension von „Gewissensbisse“ in
Ralf E. Streibl hat eine Rezension von „Gewissensbisse“ in 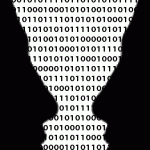 Das aktuell zur Diskussion gestellte Fallbeispiel
Das aktuell zur Diskussion gestellte Fallbeispiel  Beiträge als RSS abonnieren
Beiträge als RSS abonnieren
Kommentare